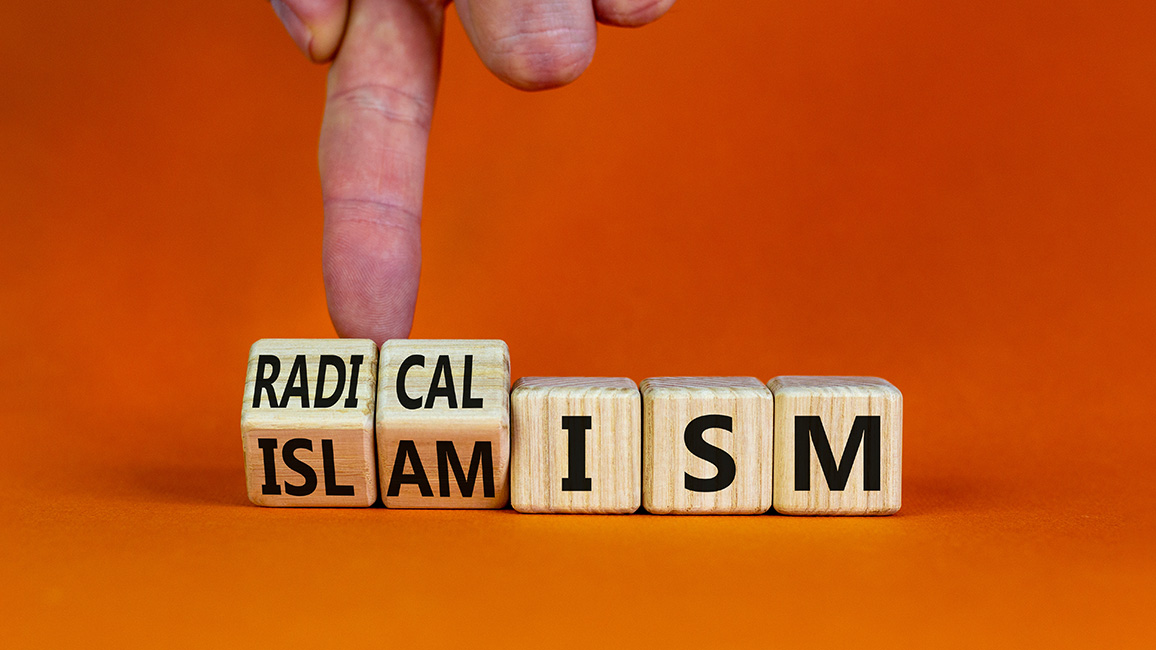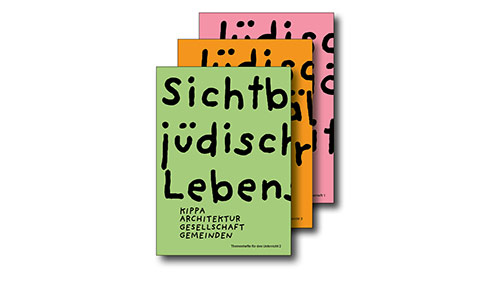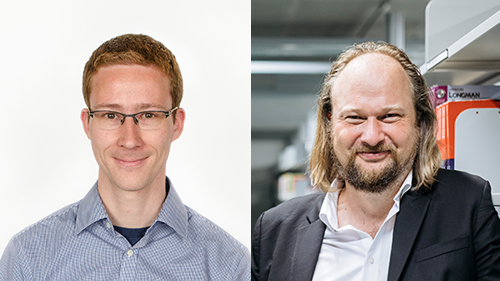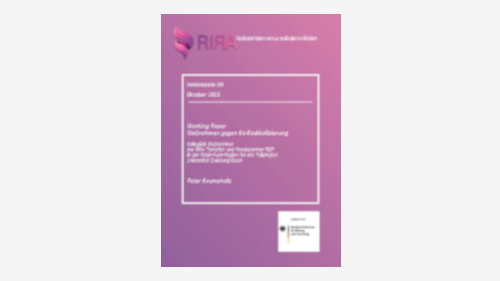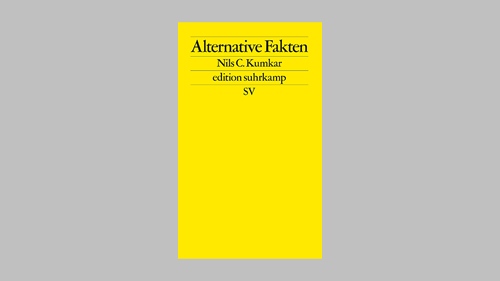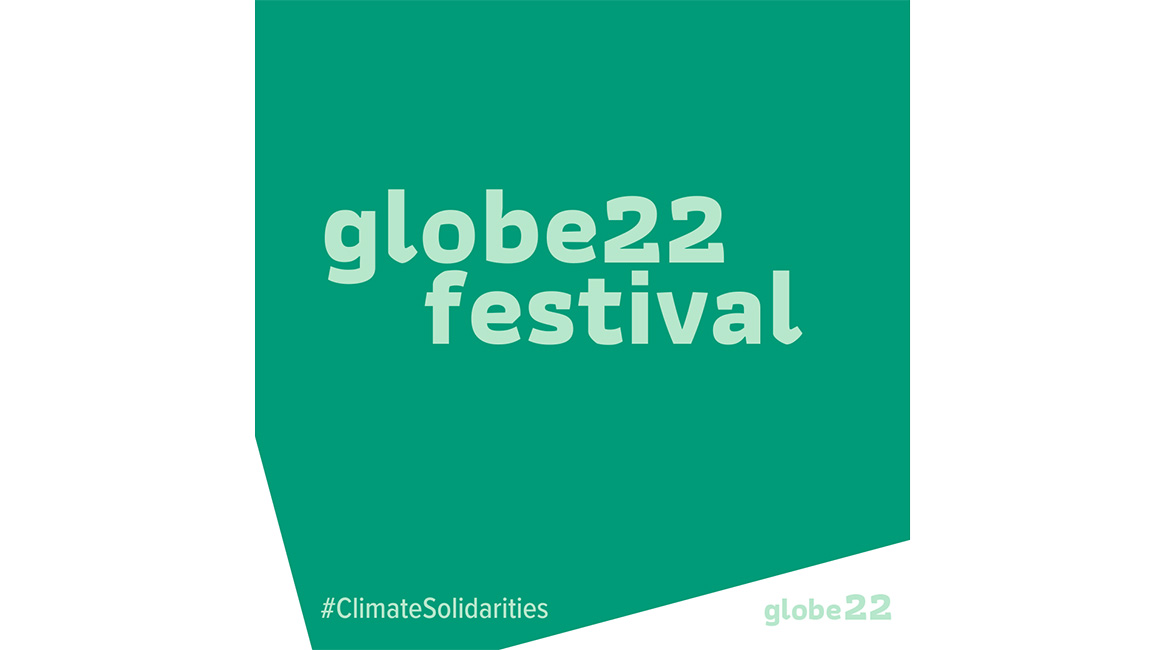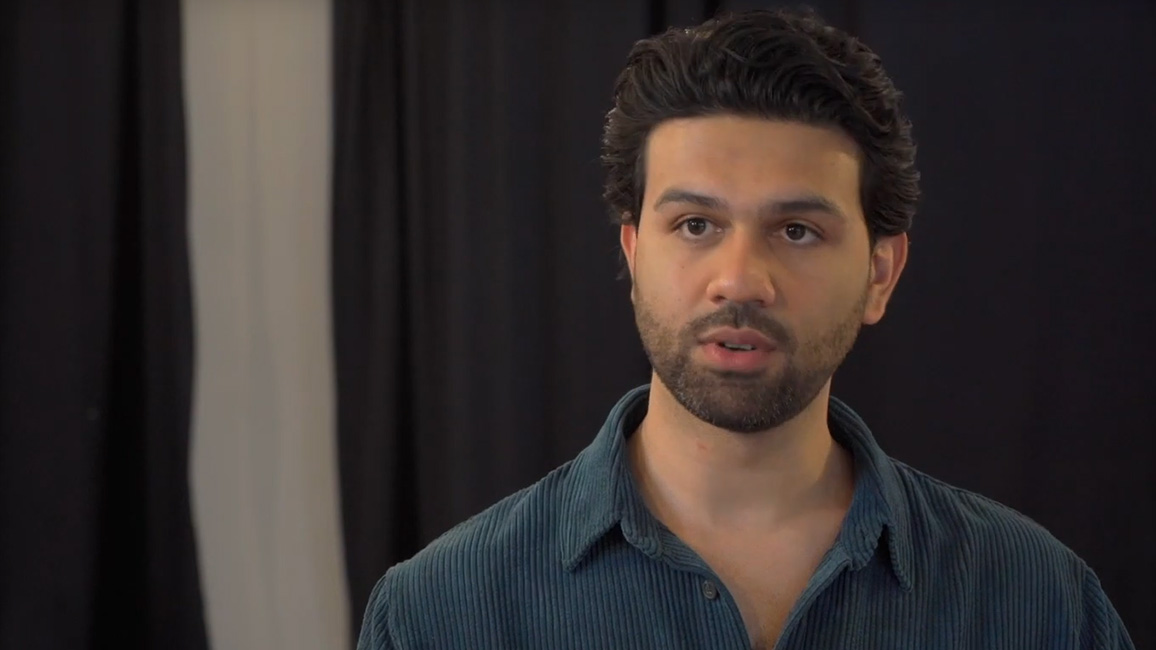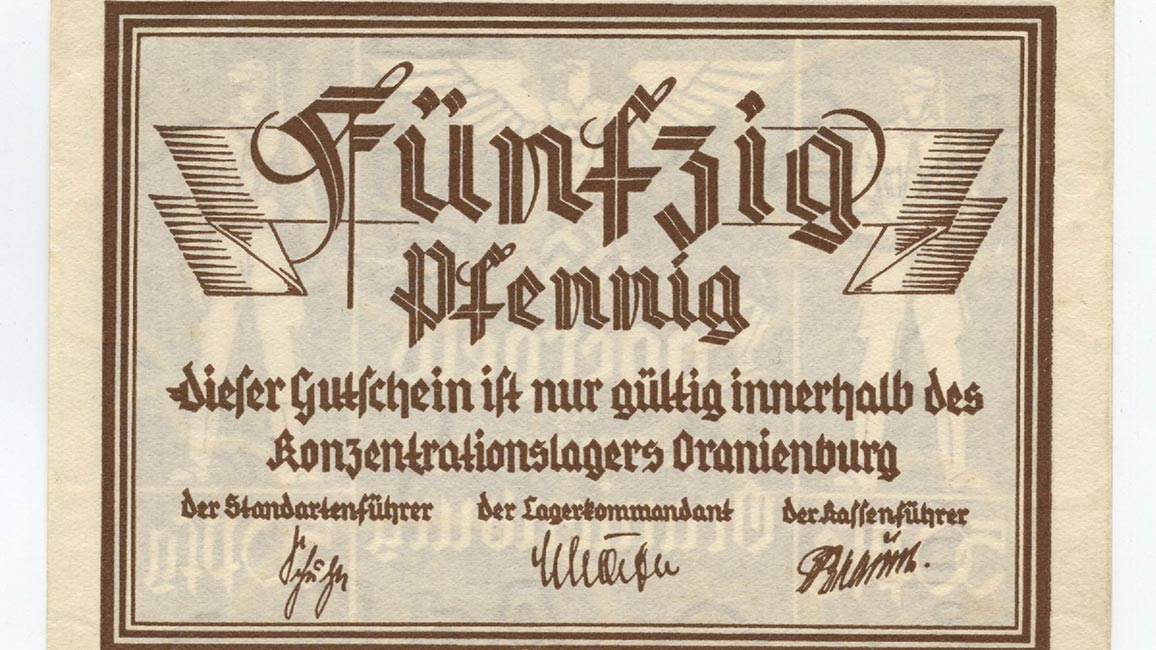Die Projekte werden durch das Transfervorhaben „Gesellschaftliche Ursachen und Wirkungen des radikalen Islam in Deutschland und Europa“ (RADIS) intern und extern miteinander vernetzt. Zentrale wissenschaftliche Projekterkenntnisse werden mit Maßnahmen des gesellschafts- und praxisorientierten Ergebnis- und Wissenstransfers zusammengeführt und sowohl mit der Politik, als auch mit der allgemein interessierten Öffentlichkeit in Austausch gebracht.
Islamismus ist – ebenso wie andere Formen des Extremismus – Teil der gesellschaftlichen Realität Deutschlands und vieler Länder Europas geworden – mit weitreichenden Folgen für ein friedliches, sicheres Zusammenleben, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und unsere freiheitliche Demokratie. Umso wichtiger ist es, Ursachen, Mechanismen und Auswirkungen extremistischer Ideologien zu verstehen. Denn nur mit diesem Wissen kann es gelingen, gesellschaftliche Risikofaktoren zu identifizieren und demokratische Werte zu stärken.
In den bislang geförderten Vorhaben wurde untersucht, ob und inwiefern sich der Einfluss von Islamistinnen und Islamisten auf das gesellschaftliche Leben, auf Verunsicherungen und auf (wahrgenommene) Bedrohungen auswirkt, welche verschiedenen Strömungen des Islamismus es gibt und wie die Gesellschaft insgesamt bzw. Teile der Gesellschaft damit umgehen. Ebenso wurden verschiedene mögliche Ursachen islamistischer Radikalisierung auf individueller, institutioneller und gesellschaftlicher Ebene in den Blick genommen.
RADIS-Forschung: Ergebnisse und Handlungsempfehlungen
Die Ergebnisse der Projekte wurden auf der RADIS-Transfer- und Abschlusstagung am 08. April 2025 in Berlin vorgestellt, an der mehr als 100 Forschende sowie Vertreterinnen und Vertreter der Präventionspraxis und Politik, aus Verwaltung, Medien und Zivilgesellschaft zusammenkamen. Ergebnisse und Empfehlungen aus über vier Jahren Forschung wurden diskutiert und mit aktuellen Herausforderungen abgeglichen. Auch zentrale Ansatzpunkte für die zukünftige Forschungs- und Präventionsarbeit sowie für Politik und Gesellschaft wurden auf der Tagung aufgezeigt.
So solle die Zusammenarbeit zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren gestärkt werden, um langfristige, breit angelegte und transferorientierte Forschung sowie wirkungsvolle Präventionsarbeit zu gewährleisten. Pädagogische Fachkräfte sollten ausgebildet und geschult werden. Muslimische Communities sollten aktiv und gesellschaftspolitisch einordnend auf islamistische Anschläge reagieren, so die Forschenden. Radikalisierungs- und Co-Radikalisierungsspiralen müssten verhindert werden, indem Maßnahmen zur Demokratieförderung, Stärkung von gesellschaftlicher Teilhabe und Vielfalt sowie Antirassismus-Arbeit unterstützt und weiterentwickelt werden sowie langfristig angelegt sein sollten. Auch die hochdynamischen islamistischen Botschaften an immer jünger werdende Jugendliche in den Sozialen Medien (Instagram, TikTok etc.) und auf Plattformen im Internet (YouTube) seien unmittelbar und langfristig wirkungsvoll zu bekämpfen, um weitere Polarisierung und Spaltung zu verhindern.
Die Projektergebnisse sind in der Kurzfassung „Islamismus als gesellschaftliche Herausforderung“ auf der RADIS-Webseite abrufbar.
Neue Förderrichtlinie: Aktuelle Herausforderungen des Islamismus im Blick
Aufgrund der nach wie vor bestehenden Herausforderungen, vor die der Islamismus westliche Gesellschaften und ihre liberalen Grundordnungen stellt, setzt das BMFTR sein Engagement im Kampf gegen Islamismus fort: Um die aktuellen, dringlichen Fragen in diesem Themenkomplex forschungsbasiert beantworten und der islamistischen Radikalisierung von immer Jüngeren entschieden entgegnen zu können, stellt das BMFTR weitere Fördermittel für die Islamismusforschung im Rahmen der Förderrichtlinie „Islamismus: Auswirkungen, Gegenstrategien und Präventionsmaßnahmen“ bereit. Nach einem wissenschaftsgeleiteten Auswahlprozess sollen die neuen Projekte im Frühjahr 2026 starten.