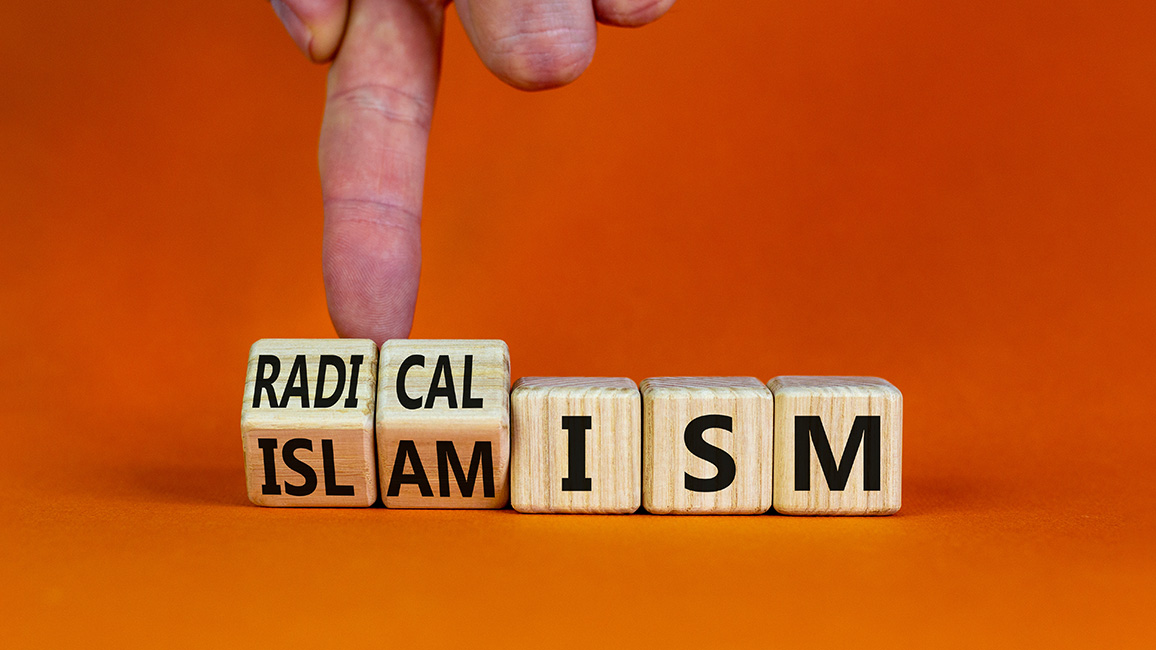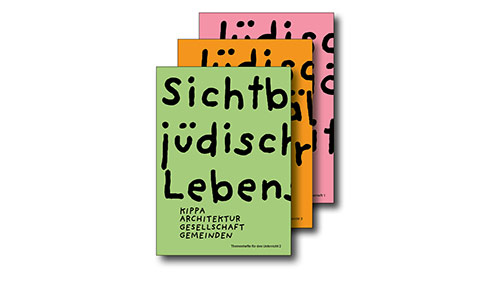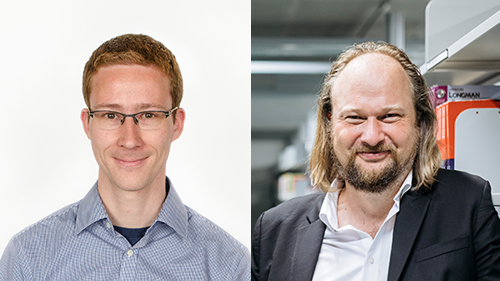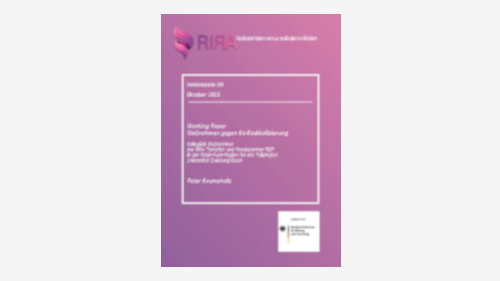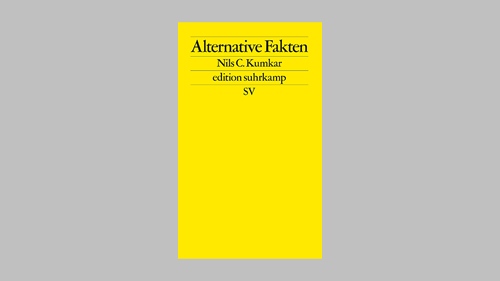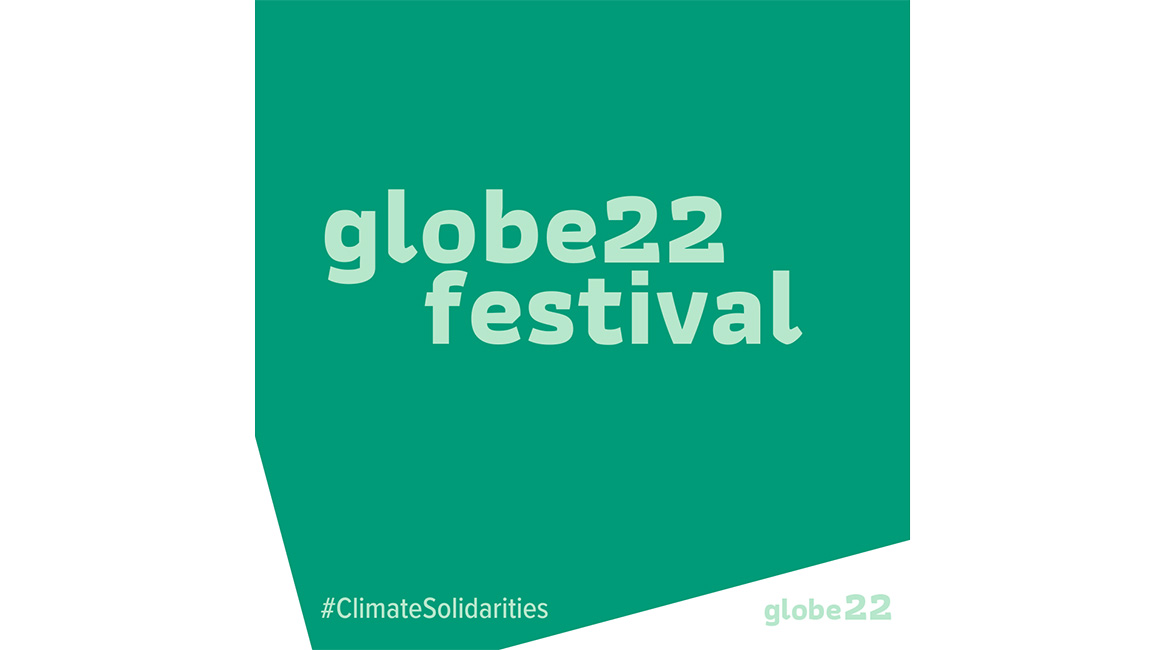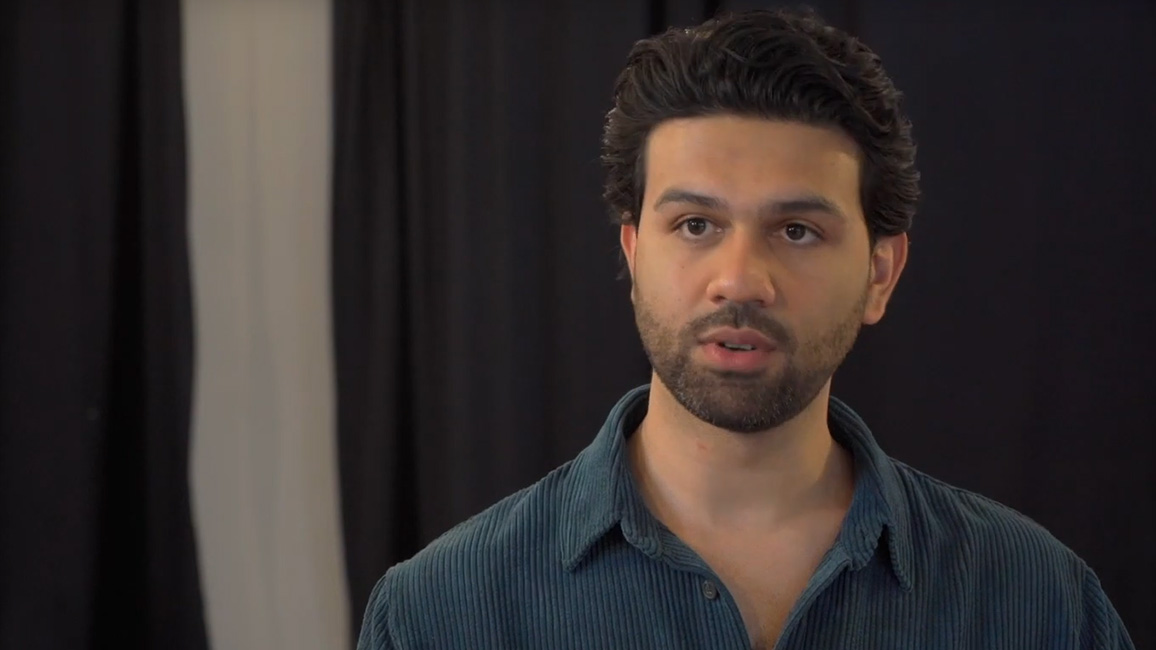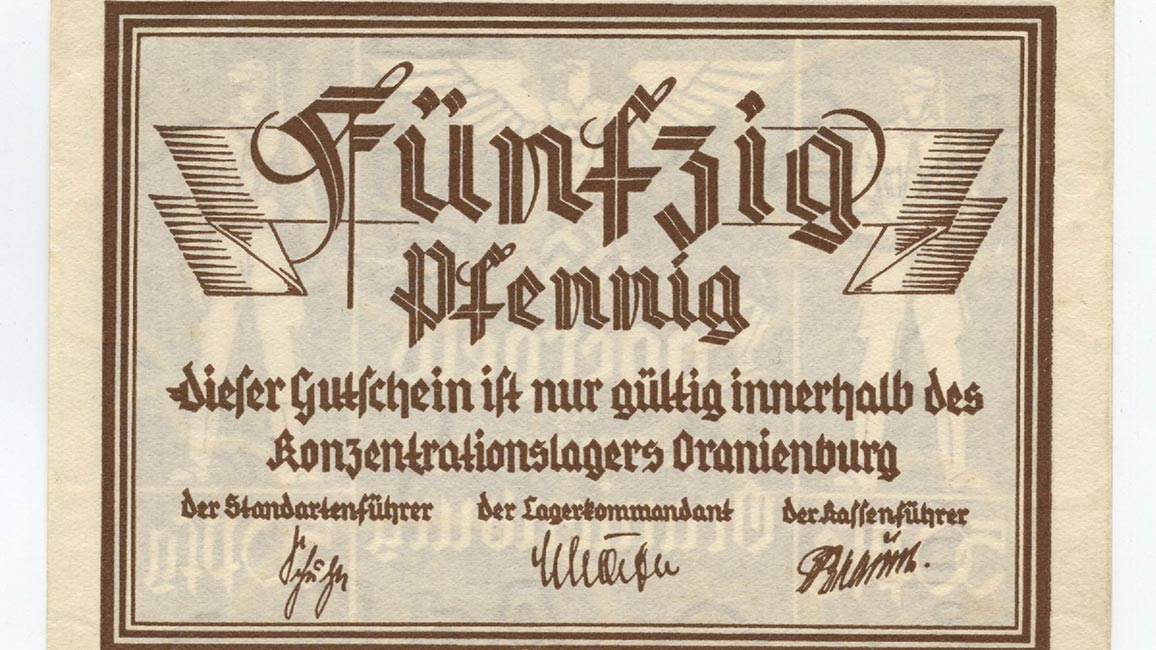Gesellschaftliche Innovationen sind mehr als ‚nette‘ Ideen – sie sind ein entscheidender Wegbereiter für zukunftsfähige, lebenswerte Regionen. Ob gemeinschaftliches Arbeiten oder Wohnen, solidarische Landwirtschaft oder selbstorganisierte Mobilität: Gesellschaftliche Innovationen entstehen meist dort, wo Menschen gemeinsam Lösungswege für gesellschaftliche oder strukturelle Herausforderungen entwickeln. Sie sind an regionale Bedürfnisse angepasst, verändern das Zusammenleben positiv und stärken daher sowohl Gemeinwohl als auch Zusammenhalt. Aber wie entstehen diese Innovationen, die nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich etwas bewegen?
Zukunftsweisende Förderlinie
Wie lassen sich komplexe Innovationszusammenhänge auf regionaler Ebene darstellen? Und wie können insbesondere strukturschwache Regionen durch Innovationen Wandel anstoßen und erfolgreich gestalten? Dazu hat das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) im August 2021 die Förderlinie „Regionale Faktoren für Innovation und Wandel erforschen – Gesellschaftliche Innovationsfähigkeit stärken“ veröffentlicht. Durchgeführt wird sie im Rahmen des BMFTR-Programms „REGION.innovativ“. Der Fokus liegt auf neuen oder bisher nur wenig beachteten sozial- und gesellschaftswissenschaftlichen Erklärungsansätzen für Innovationszusammenhänge, die sich am gesellschaftlichen Nutzen und den Nachhaltigkeitszielen orientieren.
14 Projekte: Forschung trifft Praxis
Zwischen September 2022 und Januar 2023 haben 14 Projekte aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, darunter sieben Verbundprojekte (Projektübersicht (PDF)), die Arbeit aufgenommen. Zusammen mit Praxispartnern analysieren sie gesellschaftliche Innovationsfähigkeit aus unterschiedlichen Perspektiven und in unterschiedlichen Bereichen und Regionen. Ziel ist, besser zu verstehen, wie Innovationen in bestimmten Regionen entstehen – und was sie fördert oder bremst. Ob in der Lausitz, im Rheinischen Revier oder im ländlichen Raum, es geht darum, diese Innovationspotenziale sichtbar zu machen und konkrete Vorschläge zu entwickeln, wie Menschen vor Ort Innovationen anstoßen und umsetzen können.
Abschlussveranstaltung: Neue Ansätze für Forschung und Region
Auf der Online-Abschlussveranstaltung am 3. Juni 2025 präsentierten die BMFTR-Projekte ihre bisherigen Erkenntnisse und auch praktische Ansätze für strukturschwache Regionen – von der Pflege bis zur Landwirtschaft, von lokalen Netzwerken bis zum umfassenden Strukturwandel. Die Fachveranstaltung führte rund 50 Forschende aus den 14 Projekten zusammen. Nach der Kurzvorstellung der bisherigen Projektergebnisse tauschten sich die Forschenden über ihre Ansätze, Handlungsempfehlungen und Transfermaßnahmen aus. Impulse zu übergreifenden Themen widmeten sich der Steuerbarkeit von Sozialen Innovationen und den Handlungsempfehlungen für die Unterstützung strukturschwacher Regionen.
Verstehen, vernetzen, voneinander lernen
Ein zentrales Ergebnis der bisherigen Forschung: Gesellschaftliche Innovationen entstehen nicht im luftleeren Raum – sie entwickeln sich dort, wo Menschen gemeinsam nach neuen Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen suchen.
Eine weitere Erkenntnis aus den Diskussionen: DIE strukturschwache Region gibt es nicht, sie alle haben ganz unterschiedliche Herausforderungen und Potenziale. Entscheidend ist, dass unterschiedliche Akteure an einem Strang ziehen. Auch mit knappen Mitteln lassen sich starke Impulse setzen, durch zivilgesellschaftliches Engagement und soziale Orte. Die Wissenschaft kann dabei als Vermittlerin fungieren zwischen lokalen Akteuren wie Ehrenamtliche, Vereine oder Kommunalpolitik, wenn es darum geht, die Zukunftsfähigkeit ländlicher Regionen partizipativ zu gestalten. Offene Beteiligungsprozesse sind entscheidend, damit soziale Innovationen entstehen können.
Um Wandel voranzutreiben sind stärkere interregionale Netzwerke und der Dialog mit Akteuren außerhalb der eigenen Region von großer Bedeutung und sollten gezielt gefördert werden. Insbesondere in ländlichen, strukturschwachen Regionen kann die gemeinsame Reflexion und Zusammenarbeit über Regionsgrenzen hinweg – etwa zu konkreten Themen wie die Energiewende –entscheidende Entwicklungsschübe auslösen.
Mit dem Rahmenprogramm „Gesellschaft verstehen – Zukunft gestalten“ stärkt das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) die Forschung zu gesellschaftlicher Innovationsfähigkeit. Unter „Gesellschaftlicher Innovationsfähigkeit“ wird die Fähigkeit verstanden, Neuerungen hervorzubringen und diese in besonderer Weise auch auf die Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen auszurichten sowie gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Es geht also um nichts Geringeres als Forschungen, die die sozialen, politischen, kulturellen und ökonomischen Grundlagen der ‚Innovationsgesellschaft‘ von morgen in den Fokus rücken.