Osteuropäische Geschichte: Im Interview Prof. Dr. Joachim von Puttkamer
Die Hintergründe und Folgen des Ukraine-Kriegs analysieren – welchen Beitrag leisten die Geistes- und Sozialwissenschaften?
Die Hintergründe und Folgen des Ukraine-Kriegs analysieren – welchen Beitrag leisten die Geistes- und Sozialwissenschaften?
Univ.-Prof. Dr. Joachim von Puttkamer, Lehrstuhlinhaber Osteuropäische Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Co-Direktor des Imre Kertész Kollegs
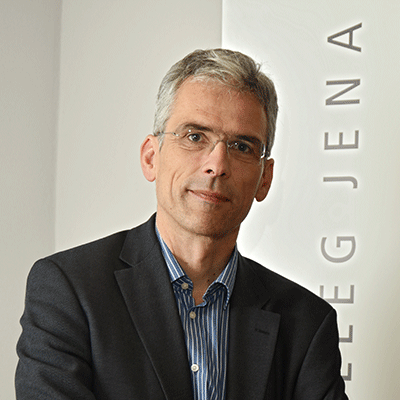
Univ.-Prof. Dr. Joachim von Puttkamer, Lehrstuhlinhaber Osteuropäische Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Co-Direktor des Imre Kertész Kollegs
FSU Jena/Anne Günther
Was will Putin? Was meint er damit, die Ukraine vom Faschismus befreien zu wollen? Hätte sich der russische Angriff vorhersehen lassen, und hätte er durch kluge Politik vermieden werden können?
In den Tagen unmittelbar vor und nach der russischen Invasion sind wir vielfach darum gebeten worden, die unmittelbaren, aber auch die längeren historischen Hintergründe dieses Krieges zu erläutern. Es ging vor allem um die Motive Putins und sein Geschichtsbild.
In diesen Fragen spiegelt sich der weit verbreitete Eindruck, dass Putin eine einsame Entscheidung getroffen hat. Ich habe in den vielen Anfragen unterschiedlicher Medien das Bedürfnis wahrgenommen, Putin mit wissenschaftlicher Autorität zu widersprechen und damit all denjenigen in Deutschland entgegenzutreten, die weiterhin Verständnis für ihn aufbringen wollen. Klare Worte zu finden, ohne sich instrumentalisieren zu lassen, ist für Wissenschaftler ein schmaler Grat.
Die Frage, ob Putins Argumente stichhaltig seien, zeigt im Übrigen auch, dass die breitere Öffentlichkeit in Deutschland mit der Geschichte der Ukraine kaum vertraut ist.
Uns Historiker treibt seither schließlich auch, wie viele andere, die ganz konkrete Frage um, wie wir geflüchteten Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine helfen können und welche Kontakte zu einzelnen russischen Wissenschaftlern wir aufrechterhalten sollen, ja müssen. Für eine Zukunft nach dem Krieg.
Das Fach leistet derzeit Enormes. An fast allen Standorten, an denen die Osteuropäische Geschichte in Deutschland vertreten ist, hat es in den letzten Wochen Podiumsdiskussionen gegeben, die riesigen Zuspruch gefunden haben. Wir geben eine Vielzahl an Hintergrundinterviews, für Printmedien ebenso wie für Radio oder soziale Medien. Einige Kollegen gehen in Schulen, um dort über die Hintergründe und die Dimension dieses Krieges zu berichten. Andere haben in herausgehobenen Zeitungsbeiträgen unterschiedliche Dimensionen dieser Zeitenwende ausgeleuchtet.
Mit ihrer wissenschaftlichen Expertise kann die Osteuropäische Geschichte inhaltlich vor allem zu drei Aspekten Orientierung bieten:
Sie kann erstens die Geschichte der Ukraine als eigenständiger Nation im europäischen Kontext verständlich machen und deren historische Wurzeln aufzeigen. Sie kann diskutieren, wie sich ukrainisches Eigenständigkeitsbewusstsein und Selbstbehauptungswillen seit 1991 entwickelt haben, in der Orangenen Revolution von 2004 und durch den Euromaidan 2014. Die Ukraine mag eine vergleichsweise junge Nation sein. Aber das gilt auf jeweils eigene Weise ja auch für Norwegen, Irland oder die Slowakei, um nur einige Beispiele zu nennen.
Die Osteuropäische Geschichte kann zweitens verständlich machen, wie sich das Verhältnis zwischen der russischen und der ukrainischen Gesellschaft über das 20. Jahrhundert hinweg verändert hat, wie eng sie miteinander verflochten und wie fremd sie einander in den letzten Jahren geworden sind.
Schließlich kann sie, drittens, aufzeigen, welche wissenschaftlichen Kontroversen um zentrale Motive der russischen Kriegsbegründung geführt werden, etwa zum behaupteten Stellenwert rechtsradikaler Gruppierungen in der Ukraine oder zum Verhältnis zwischen NATO und Russland.
Vieles davon hat unmittelbar auch mit der deutschen Geschichte zu tun. Die Frage, welche Verantwortung aus der Geschichte deutscher Besatzung der Ukraine im Zweiten und übrigens auch schon im ersten Weltkrieg erwächst, ist keine wissenschaftliche Frage. Aber sie kann nur auf einem wissenschaftlichen Fundament beantwortet werden.
Wir wissen viel zu wenig darüber, wie sich die russische Gesellschaft seit 1991 verändert hat. Wir haben die wachsende Gewaltbereitschaft von Putins Regime nach innen und außen mitverfolgt, wir kennen zentrale Denkmuster der neoimperialen Ideologie, wir haben ein grobes Verständnis von den inneren Zirkeln der Macht und wir sehen, wie die Möglichkeiten, sich dagegen aufzulehnen, immer enger geworden sind. In den vergangenen Jahren hat sich die Osteuropäische Geschichte viel damit auseinandergesetzt, wie russisches imperiales Denken und Handeln in der Sowjetunion weiterwirkte und welche globalen Auswirkungen das hatte. Darüber sind die inneren Spannungen und Brüche in den Hintergrund getreten. Die Russische Revolution, Stalinismus und Zweiter Weltkrieg, Perestroika und die schwere Krise der 1990er Jahre haben in der russischen Gesellschaft tiefe Spuren hinterlassen. Wir könnten allenfalls in Umrissen sagen, welche Schichten heute dem Westen kulturell zugewandt sind und welche vielmehr die neoimperialen Visionen Putins mittragen, vielleicht sogar antreiben. Auf die Frage, an welches demokratische Potential Russland nach Putin historisch anknüpfen könnte, sind wir nicht gut vorbereitet.
Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Prof. von Puttkamer!
(Das Interview erfolgte schriftlich am 24.3.2022)